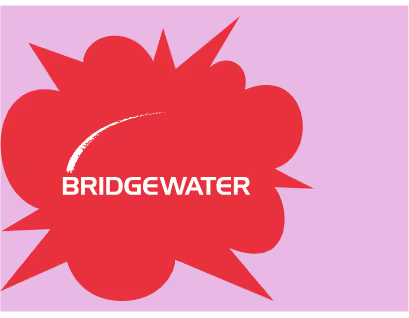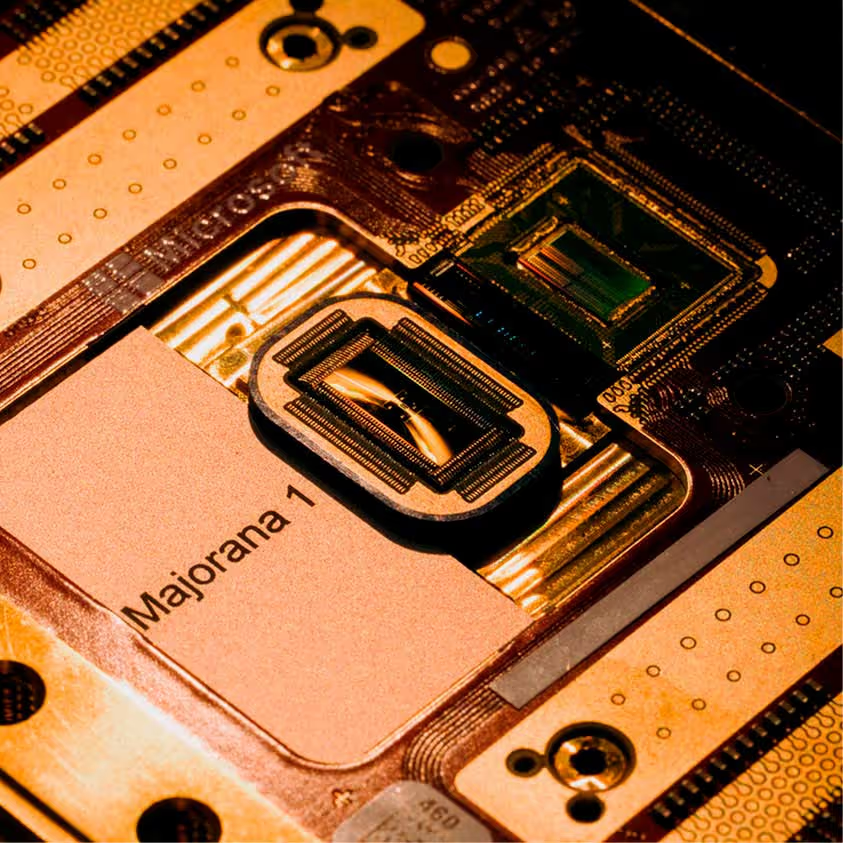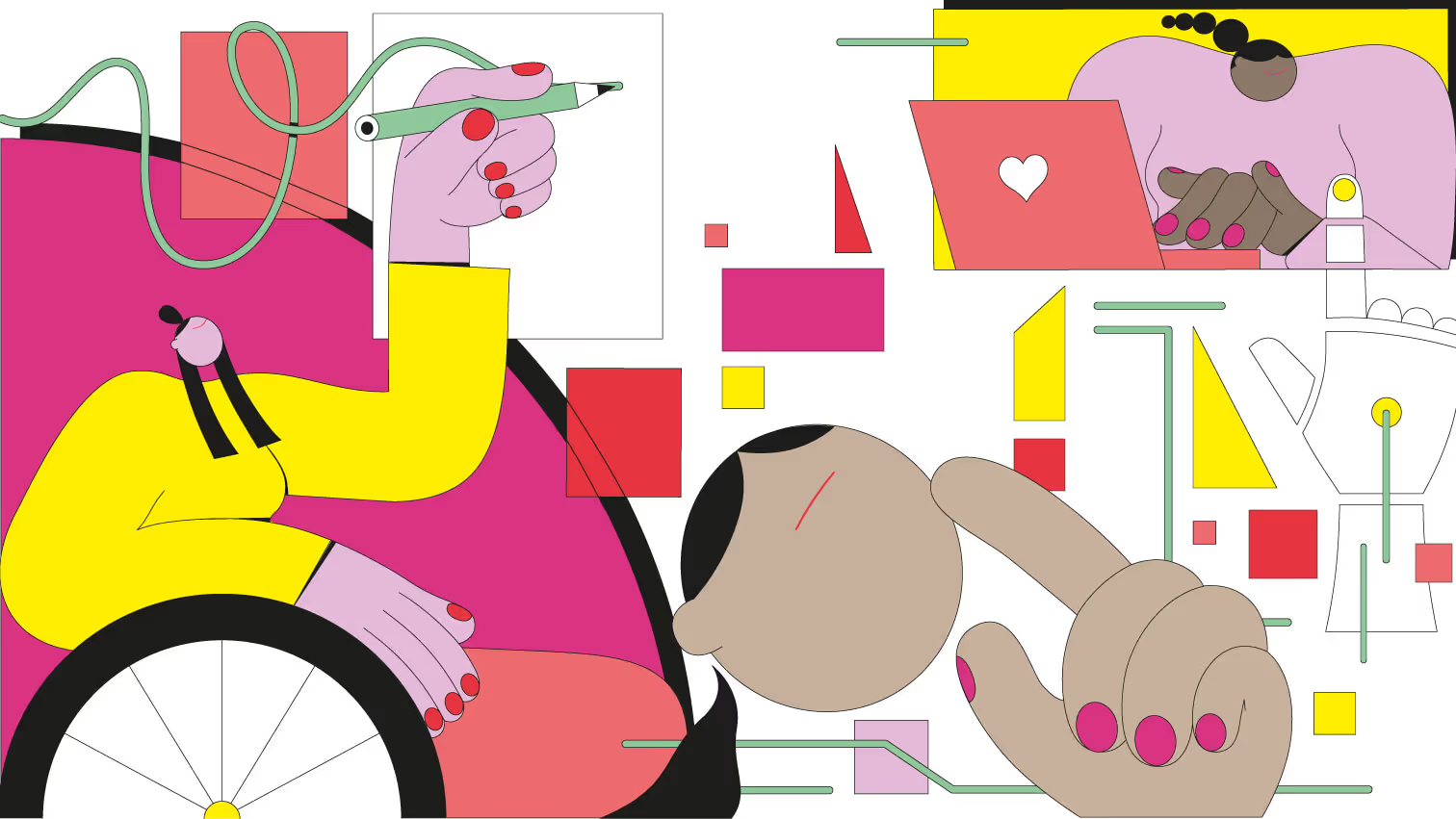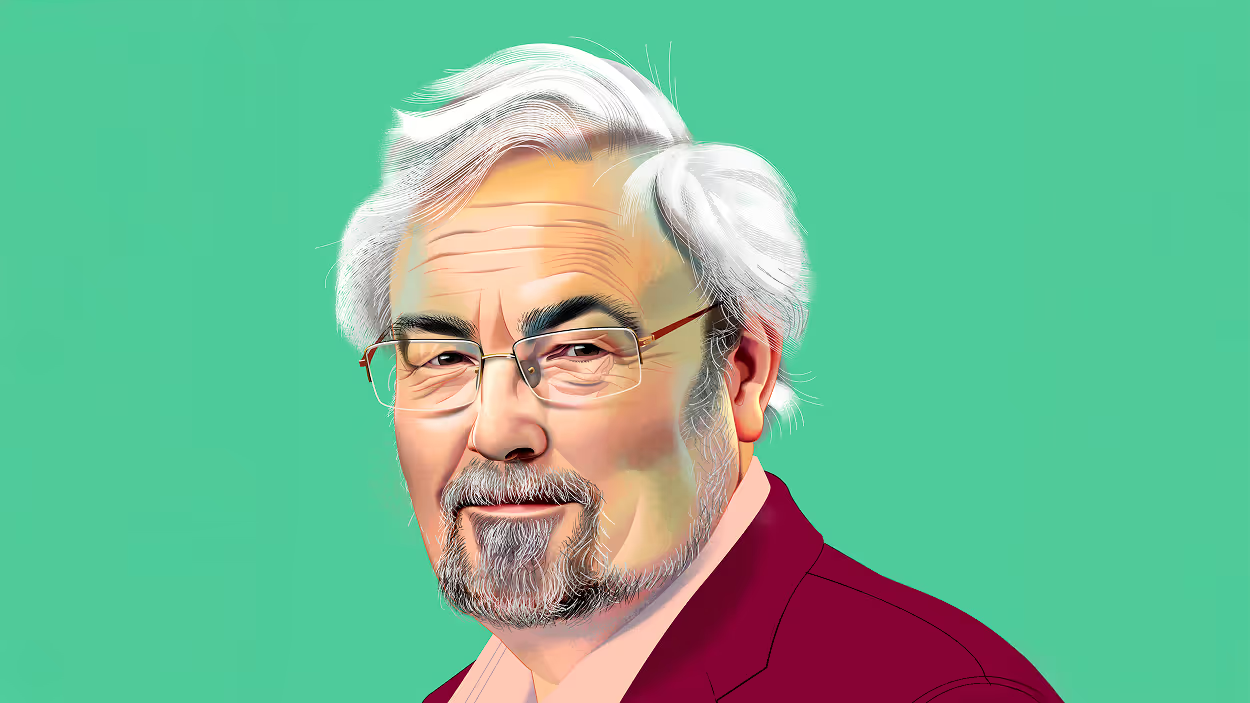Klartext als Erfolgsfaktor
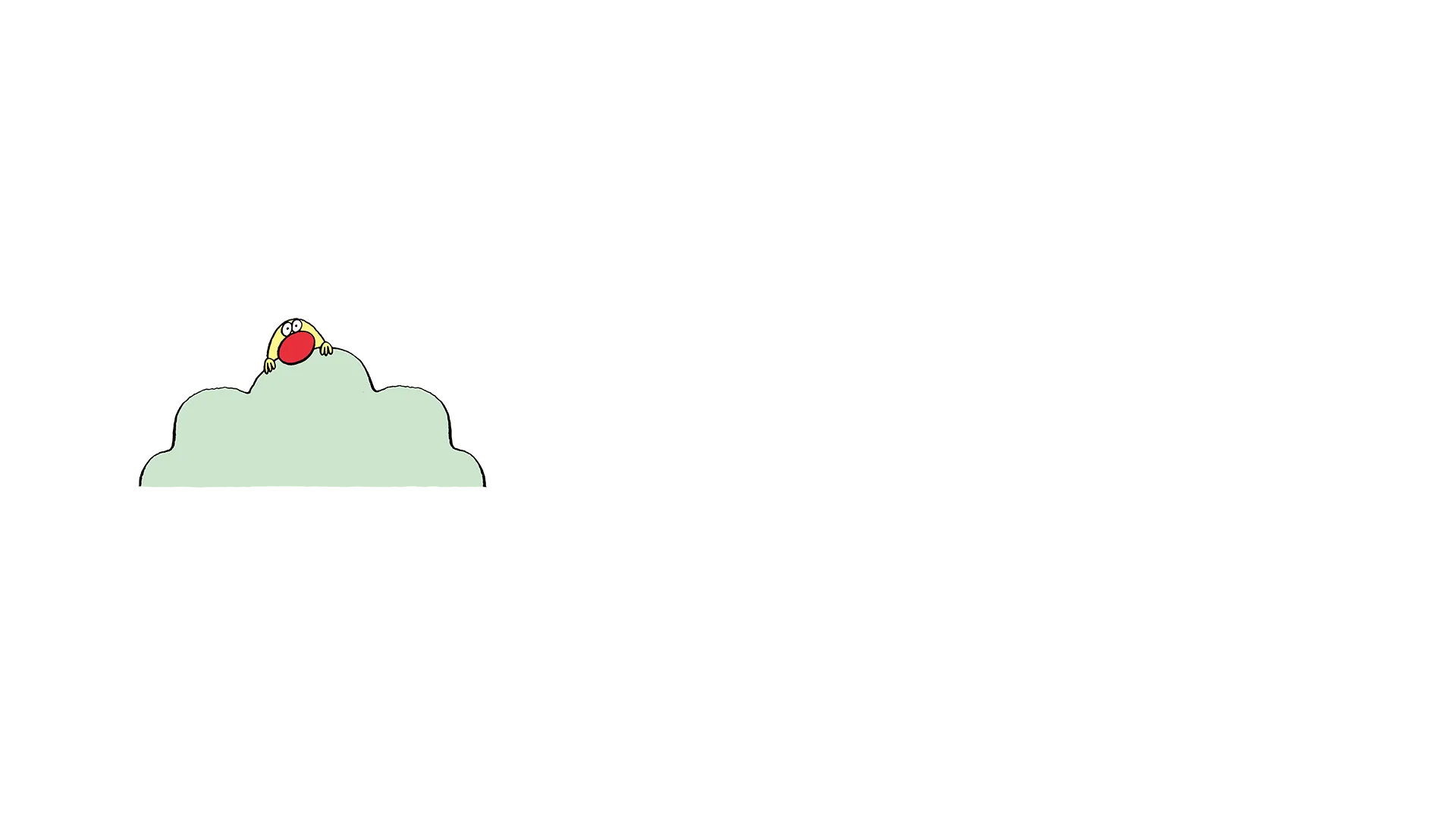

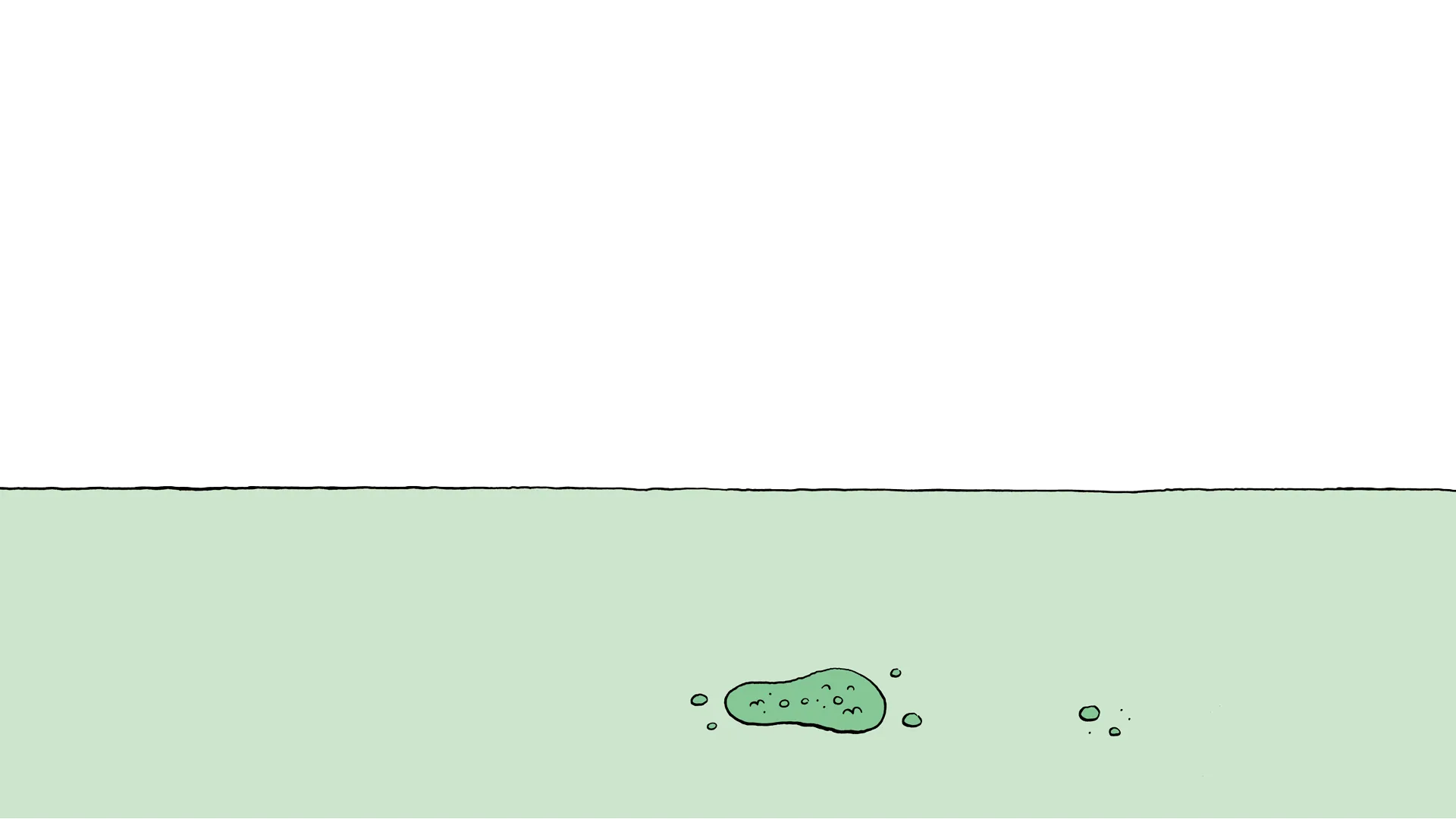
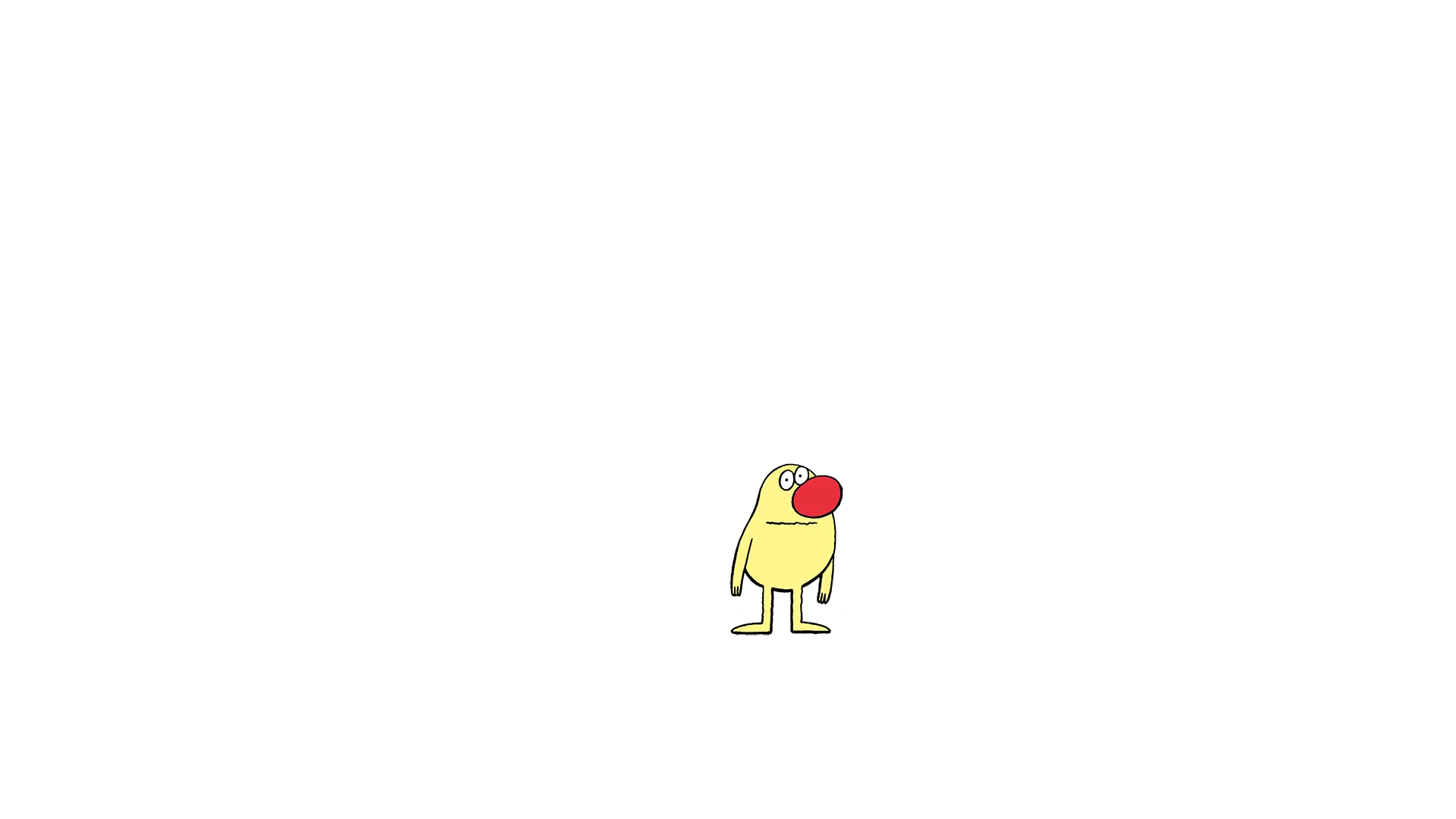
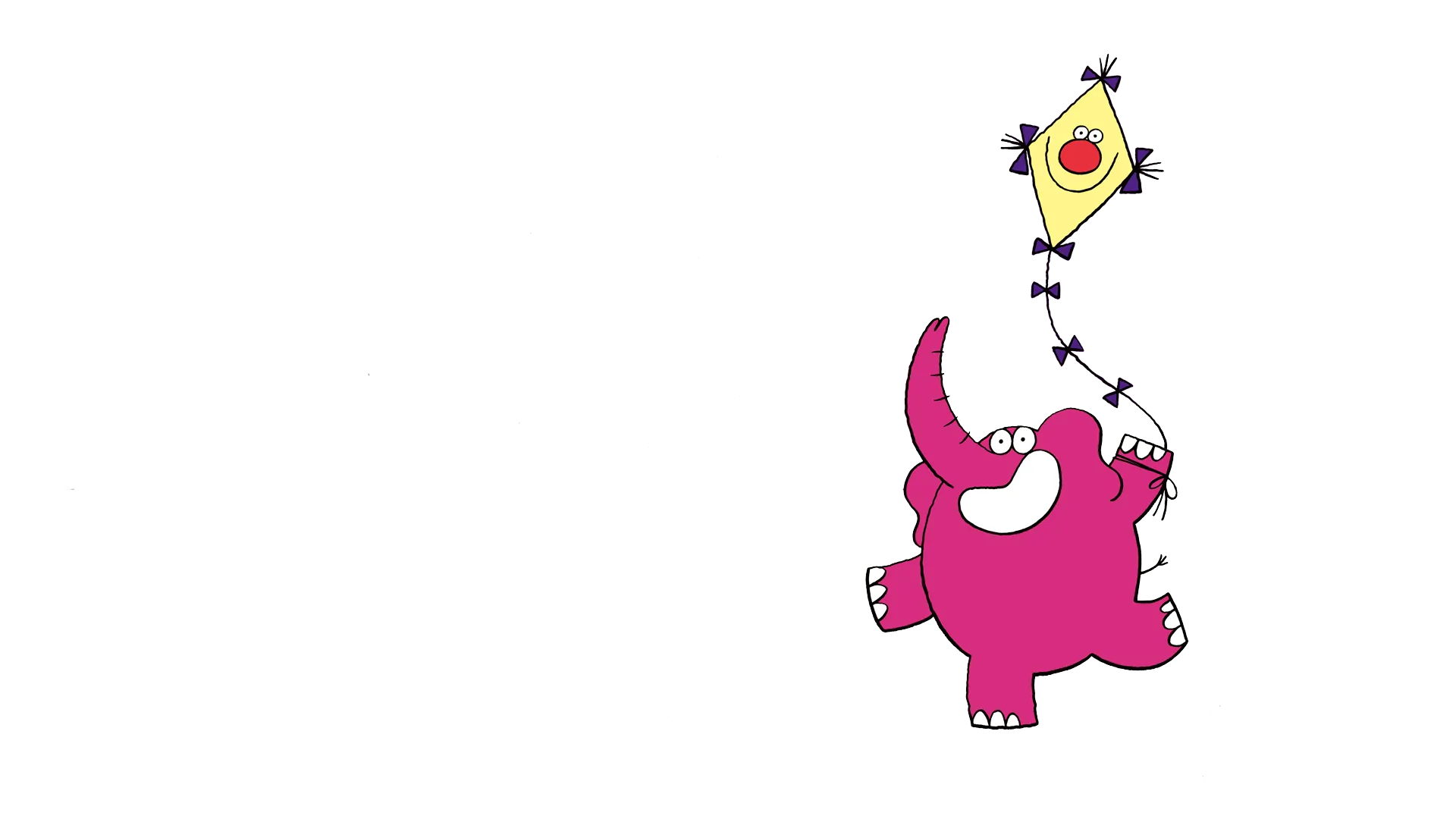

Führungskräfte, die systematisch kritische Impulse ihrer Mitarbeiter aufnehmen, schaffen nicht nur eine offene Debattenkultur. Sie stärken auch die Identifikation der Beschäftigten mit ihrer Firma. Das Unternehmen wird so dynamischer und erfolgreicher.
Kinder toben auf einem Spielplatz: Dieses Leitbild inspirierte 2017 das Management der Lego Group, als es bei stagnierenden Geschäftszahlen frischen Wind in die Unternehmenskultur bringen wollte. Wie Kinder, die in Fantasiewelten abtauchen oder auf Klettergerüsten herumkraxeln, wollte der dänische Spielzeughersteller seinen Teams ein sicheres Umfeld bieten. Sie sollten Risiken eingehen, offen sprechen und experimentieren.
Die Strategie bekam den Namen „The Leadership Playground“. Das war keine hohle Management-Rhetorik: Loren Shuster, der neue Personalchef, gründete eine bereichsübergreifende Arbeitsgruppe aus 15 Leuten, die neue Führungsprinzipien entwickelte und Rückmeldungen von Hunderten Mitarbeitern einholte. Dann rekrutierte er Freiwillige aus 1.200 Teams als „Playground Builders“, sie sollten die gemeinsam erdachte Kultur im Unternehmen verwurzeln. Acht Jahre später der Erfolg: Lego erzielte im Jahr 2024 Rekordergebnisse mit 13 % Wachstum bei rund zehn Milliarden US-Dollar Umsatz. Ein starker Beleg dafür, welche Kraft entsteht, wenn Führungsetagen den Ideen ihrer Mitarbeiter Raum geben.
Lego war nicht als erstes Unternehmen zu dieser Erkenntnis gelangt. Der frühere Red-Hat-CEO Jim Whitehurst sprach offen über die Kultur „lebhafter Debatten“, die er im Jahr 2007 in dem Softwareunternehmen antraf: Ingenieure stellten Führungsentscheidungen in Konferenzen ganz offen infrage, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. 2009 formulierte Personalchefin Patty McCord die Netflix-Werte in einem vielbeachteten „Culture Deck“. Dort stand an erster Stelle: „radikale Ehrlichkeit“. Jeder im Unternehmen sollte offen aussprechen können, was sich ändern muss, unabhängig von seinem Rang in der Hierarchie. Airbnb wiederum führte die sogenannten „Elephant, Dead Fish, Vomit“-Runden ein, um „furchtloses Feedback“ zu fördern: Teams sollen Probleme (Elefanten), vergangene Fehler (tote Fische) und belastende Themen (Erbrochenes) ansprechen.
Doch diese Beispiele beschreiben eher die Ausnahme als die Regel. In den meisten Firmen herrscht eine Unternehmenskultur vor, die Whitehurst als „tödliche Harmoniesucht“ bezeichnet. Mitarbeiter behalten ihre Gedanken, Ideen und Kritik für sich. Je größer ein Unternehmen wird, desto zentralisierter werden alle Entscheidungen, erklärt Karin Hurt, Co-Autorin des Buches Courageous Cultures. „Zu Beginn herrscht eine sehr unternehmerische, geradezu anarchische Haltung, alle Ideen sind willkommen“, erklärt sie. „Doch wenn Organisationen wachsen und ihre Strategie schärfen, wird die Entscheidungsfindung zentraler.“ Eine notwendige Entwicklung: „Man kann nicht wachsen, wenn 200 Menschen bei allem mitreden. Aber es gibt einen Punkt, an dem sich klare Führung und innovative Impulse in Unternehmen optimal ergänzen.“
Wie erreicht man diese Balance? Kim Scott fand eine Antwort, als Sheryl Sandberg ihr während ihrer Zeit als Google-Managerin mitteilte, sie klinge „dumm“ – ein Moment, der Scott dazu brachte, den Wert von offenem, ehrlichem Feedback am Arbeitsplatz grundlegend zu überdenken. Scott, die später als Coach für Spitzenmanager bei Technologieunternehmen wie Dropbox und Twitter arbeitete, schrieb ihre Erkenntnisse in dem Buch Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity nieder.
Auch wenn Kritik schmerzen kann, ist Scott überzeugt, dass Kulturen „mitfühlender Offenheit“ Unternehmen dynamischer und erfolgreicher machen. Solche Ansätze verhindern, dass Führungskräfte blinde Flecken entwickeln. „Schmeicheleien kommen auf Sie zu wie dichter, gefährlicher Nebel. Der einzige Weg, ihn zu durchdringen und den Leuchtturm zu finden, ist, Menschen zu belohnen, die Ihnen sagen, was sie wirklich denken, auch wenn es unangenehm ist“, erklärt Scott. Wie der frühere Intel-CEO Andy Grove einst feststellte: Die Führung mag im Zentrum einer Organisation sitzen, doch „Schnee schmilzt an der Peripherie.“ Oder in Scotts Worten: „Das größte Risiko für Führungskräfte ist Unwissen: Sie erfahren nicht, was wirklich passiert, wenn Menschen Angst haben, es ihnen zu sagen.“
“Es gibt einen Punkt, an dem sich klare Führung und innovative Impulse optimal ergänzen.”
“Das Ziel ist, dass Mitarbeiter und Arbeitgeber während der gesamten Dauer des Arbeitsverhältnisses immer klar verstehen, woran sie gemeinsam arbeiten und warum – wie Verbündete, die einen Bündnisvertrag unterzeichnen.”
Wer seine Mitarbeiter ernst nimmt und ihre Ideen wertschätzt, erntet echte Loyalität. Die Mission des Unternehmens wird zur gemeinsamen Sache. Diese Übereinstimmung von Firmen- und Mitarbeiterzielen, die „Zielkongruenz“, erzeugt laut Maryam Kouchaki, Managementprofessorin an der Kellogg School of Management, „eine sehr kraftvolle Dynamik. Sie motiviert die Menschen, steigert die Arbeitszufriedenheit und verringert die Fluktuation.“ Kouchaki erläutert das mit einer Geschichte von drei Maurern, die gefragt werden, was sie tun: Der erste sagt, er lege einen Stein; der zweite erklärt, er baue einen Teil einer Mauer; und der dritte antwortet: Wir errichten eine Kathedrale. Indem man eine alltägliche Tätigkeit mit einer größeren Mission verbindet, bleibt die Aufgabe dieselbe, aber die Perspektive des Mitarbeiters verändert sich.
In der heutigen Arbeitswelt ist lebenslange Beschäftigung bei einem Unternehmen selten geworden. Weniger hierarchische, wechselseitige Beziehungen sind für beide Seiten von Vorteil, meint Chris Yeh, Co-Autor von The Alliance: Managing Talent in the Networked Age. „Wir arbeiten aus Gründen, die über das monatliche Gehalt hinausgehen. Wir wollen etwas erreichen und uns beruflich weiterentwickeln. Wenn wir das deutlich machen, verhindern wir, dass Mitarbeiter ziellos vor sich hinarbeiten oder sich fragen, warum sie überhaupt im Unternehmen sind. Sie haben dann stets ein klares Zielverständnis.“
Yeh vergleicht diese offenere Beziehung mit einem „Bündnis“ zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Im Mittelpunkt steht ein definierter „Auftrag“, eine vereinbarte Aufgabe, für die der Mitarbeiter Verantwortung übernimmt. „Alle sind sich über die Erfolgskriterien einig und darüber, was die Erfüllung dieser Mission für die Karriere des Mitarbeiters, die Führungskraft und das Unternehmen insgesamt bedeutet“, erklärt Yeh. „Das Ziel ist, dass Mitarbeiter und Arbeitgeber während der gesamten Dauer des Arbeitsverhältnisses immer klar verstehen, woran sie gemeinsam arbeiten und warum – wie Verbündete, die einen Bündnisvertrag unterzeichnen.“
Bei LinkedIn eröffnete Kevin Scott, ehemaliger Senior Vice President of Engineering and Operations, Bewerbungsgespräche stets mit der Frage: Was möchten Sie tun, wenn Sie LinkedIn verlassen? „Diese Frage ist so wichtig, weil sie Managern eine Wahrheit offenbart, die wir normalerweise verbergen: Der Mitarbeiter wird nicht für immer bleiben“, sagt Yeh. So entsteht von Anfang an eine ehrliche Gesprächsebene, die auch den Bewerber zu Offenheit ermutigt.
Die Grundlage für eine radikal ehrliche Firmenkultur ist „psychologische Sicherheit“. Der von der Harvard-Professorin Amy Edmondson Ende der 1990er-Jahre erstmals verwendete Begriff bezeichnet die gemeinsame Überzeugung in einem Team, dass man zwischenmenschliche Risiken eingehen kann, zum Beispiel Ideen äußern, ohne negative Konsequenzen fürchten zu müssen. Diese Konsequenzen müssen nicht so extrem sein wie Entlassung oder Verhaftung, betont Tom Geraghty, Gründer und CEO von Psych Safety. „Es kann etwas so Subtiles sein wie ein Augenrollen oder ein genervtes Seufzen des Vorgesetzten, wenn eine Idee geäußert wird. Das kann uns auf tiefgreifende Weise beeinflussen.“
In manchen Branchen kann ein Schweigen Menschenleben kosten. Die Luftfahrtbranche und Betreiber von Atomkraftwerken haben das Konzept deshalb schnell übernommen. Nach einem Flugzeugunglück auf dem Flughafen von Teneriffa im Jahr 1977, bei dem zwei Boeing 747 auf der Startbahn kollidierten, führten alle großen Fluggesellschaften das Crew Resource Management (CRM) ein. Das gemeinsame Trainingshandbuch sollte Kommunikationsprobleme eindämmen und sicherstellen, dass alle Besatzungsmitglieder und das Bodenpersonal ihre Bedenken äußern können.
„Eine der unmittelbarsten Lehren aus der Luftfahrt war die Rolle ausgeprägter Machtgefälle – also des Unterschieds zwischen der ranghöchsten und der rangniedrigsten Person im Raum“, sagt Geraghty. „Je steiler das Gefälle, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Menschen sich äußern.“ Durch kleine Veränderungen in Mikrointeraktionen kann Führung jedoch große psychologische Wirkung entfalten. Deshalb stellen sich Piloten ihrer Crew heute mit Vornamen vor.
Mitarbeiter brauchen auch das, was Karin Hurt „strategische Klarheit“ nennt: Orientierung darüber, wo ihre Ideen willkommen sind und wo nicht. „Wer psychologische Sicherheit schafft, aber keine strategische Einordnung gibt, bekommt viele Vorschläge, aber nicht unbedingt die besten“, so Hurt.
Um das zu vermeiden, empfiehlt die Expertin offene und gezielte Kommunikationskanäle. In ihrer Forschungsarbeit zu Courageous Cultures fanden Hurt und ihr Co-Autor David Dye heraus, dass 49 % der Mitarbeiter angaben, von ihren Vorgesetzten noch nie nach Ideen gefragt worden zu sein. Ihr Rat: Sagen Sie ausdrücklich, wann Sie Feedback wünschen, und wiederholen Sie diese Einladung mindestens fünfmal auf fünf verschiedene Arten. Führungskräfte sollten außerdem konkret werden, um vage oder unbrauchbare Vorschläge zu vermeiden.
Beim britischen Infrastrukturunternehmen Balfour Beatty sammelt die Initiative „My Contribution“ Ideen für thematische Kampagnen, zum Beispiel zu Sicherheit, Nachhaltigkeit oder zur „Erholung“ nach der Covid-Pandemie. Seit dem Start 2015 wurden über 15.000 Vorschläge eingereicht. Allein im Jahr 2024 ließen sich auf diese Weise rund 53.800 Stunden Arbeitszeit und etwa vier Millionen US-Dollar einsparen.
Entscheidend ist jedoch auch, wie das Management reagiert. Zuhören, nachfragen, umsetzen: Diese drei Grundsätze sollten Führungskräfte laut Kim Scott bei Rückmeldungen aus dem Team beherzigen. Kritik an Vorschlägen sollte in Form einer „respektvollen Meinungsverschiedenheit“ erfolgen. „Aber bevor Sie widersprechen, überlegen Sie, was Ihnen die Person eigentlich sagen wollte“, rät Hurt. „Suchen Sie nach den 5 oder 10 %, denen Sie zustimmen können, und benennen Sie diese. Das zeigt, dass Sie wirklich zugehört haben.“ Hurt nennt das eine „wertschätzende Reaktion“.
Sie empfiehlt ein dreistufiges Vorgehen: „Erstens: Dankbarkeit. Nicht für die Idee selbst, die vielleicht wirklich abwegig ist – aber für den Impuls, sich Gedanken zu machen. Für den Mut, sich zu Wort zu melden. Zweitens: Information. Erläutern Sie, warum eine Idee nicht umgesetzt wird oder was noch fehlt, damit sie wirklich überzeugt.“ Wichtig sei es auch, eine Rückmeldung zu geben, wenn ein Vorschlag aus dem Team tatsächlich zu einer Veränderung geführt hat. „50 % der Befragten in unserer Studie zu Unternehmenskulturen gaben an, keine Ideen mehr zu äußern, weil sie glauben, dass ohnehin nichts aus ihren Vorschlägen wird. In den meisten Fällen fehlt der entscheidende letzte Schritt.“
Eine richtig verstandene „radikale Offenheit“ bedeutet nicht, Hierarchien oder zwischenmenschliche Grenzen abzuschaffen. Eine offene Unternehmenskultur bedeutet nicht, dass respektloses Verhalten toleriert wird, betont Scott. Offenheit ist kein Freibrief für unreflektierte Direktheit. Nur wenn Offenheit von gegenseitigem Respekt getragen wird, kann sie ihr Potenzial entfalten: als Motor für Vertrauen, Engagement und Innovation. Yeh ergänzt: Auch in offenen Kulturen bleibt Hierarchie bedeutsam. „Ein Verbündeter zu sein heißt nicht, dass man nicht zugleich Vorgesetzter dieser Person sein kann. Für uns heißt es: ehrlich sein, die andere Person als gleichwertig behandeln und dabei die eigene Führungsrolle bewusst und verantwortungsvoll ausüben.“
Offenheit allein schafft noch keine starke Unternehmenskultur. Erst wenn sie mit Orientierung, Vertrauen und klarer Führung verbunden ist, kann sie ihre Wirkung entfalten. Mitarbeiter brauchen nicht nur die Erlaubnis, sich zu äußern, sondern auch das sichere Gefühl, dass ihre Ideen willkommen sind und dass klar ist, worauf es ankommt. Führung bedeutet deshalb, einen Rahmen zu schaffen, in denen Vorschläge gedeihen können und strategische Ziele nachvollziehbar werden. So entsteht ein Umfeld, in dem Ideen nicht nur ausgesprochen, sondern auch weitergedacht werden – und in dem Offenheit zum Antrieb für konkrete Veränderung wird.
A healthy culture that values input regardless of rank or role means creating the space, safety and strategic clarity for employees to innovate, experiment and speak up, but with boundaries in place that ensure that nobody – including the wider organization – gets hurt. Just like a playground.
Immer einen Schritt voraus!
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und lassen Sie sich von Think:Act auf den neuesten Stand bringen – mit dem, was heute wichtig ist, und mit Orientierung für das, was als Nächstes kommt.