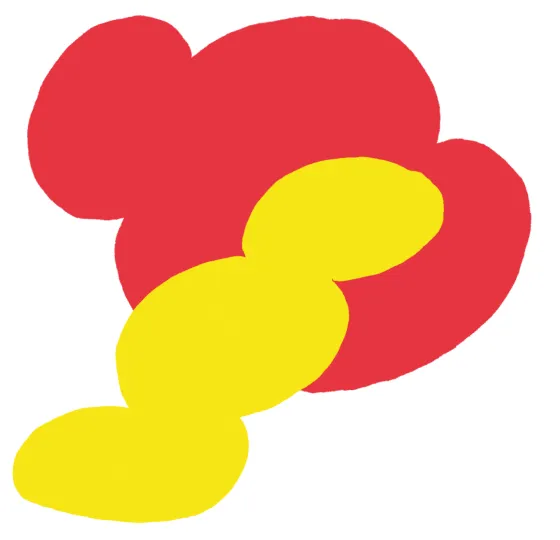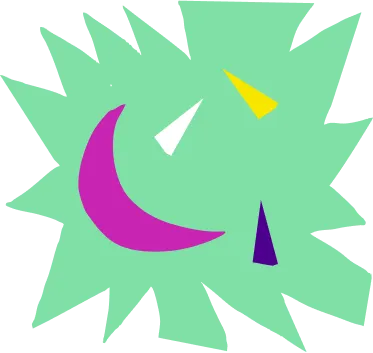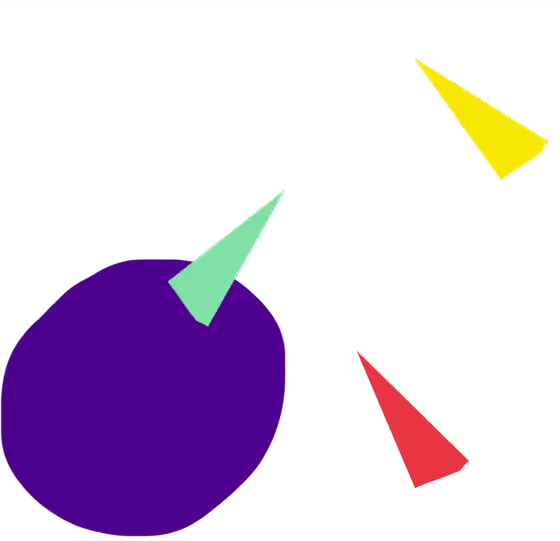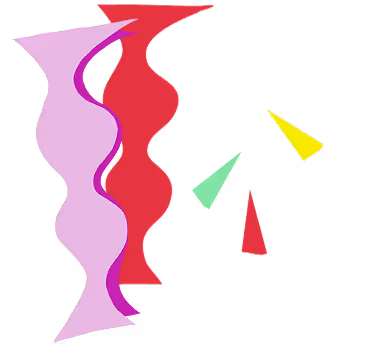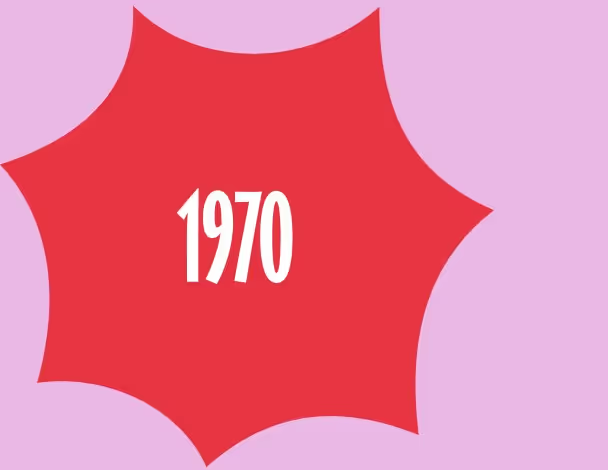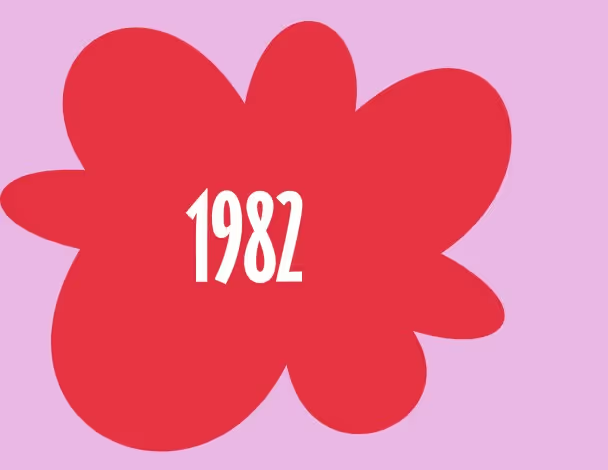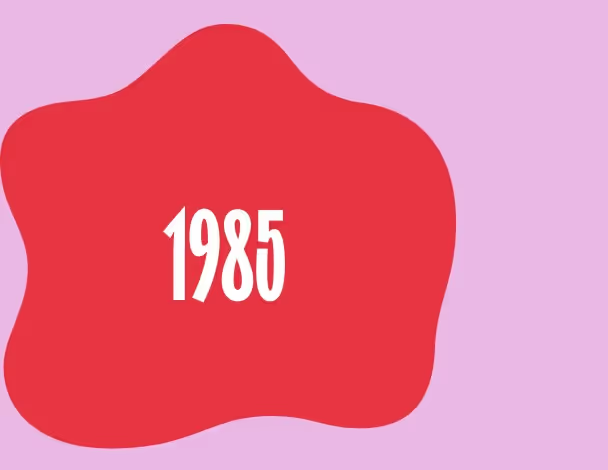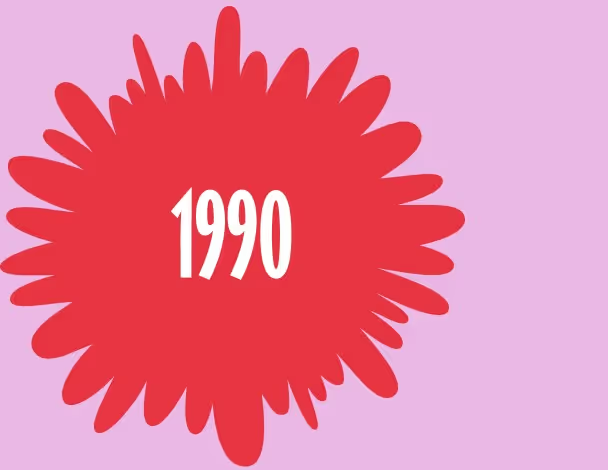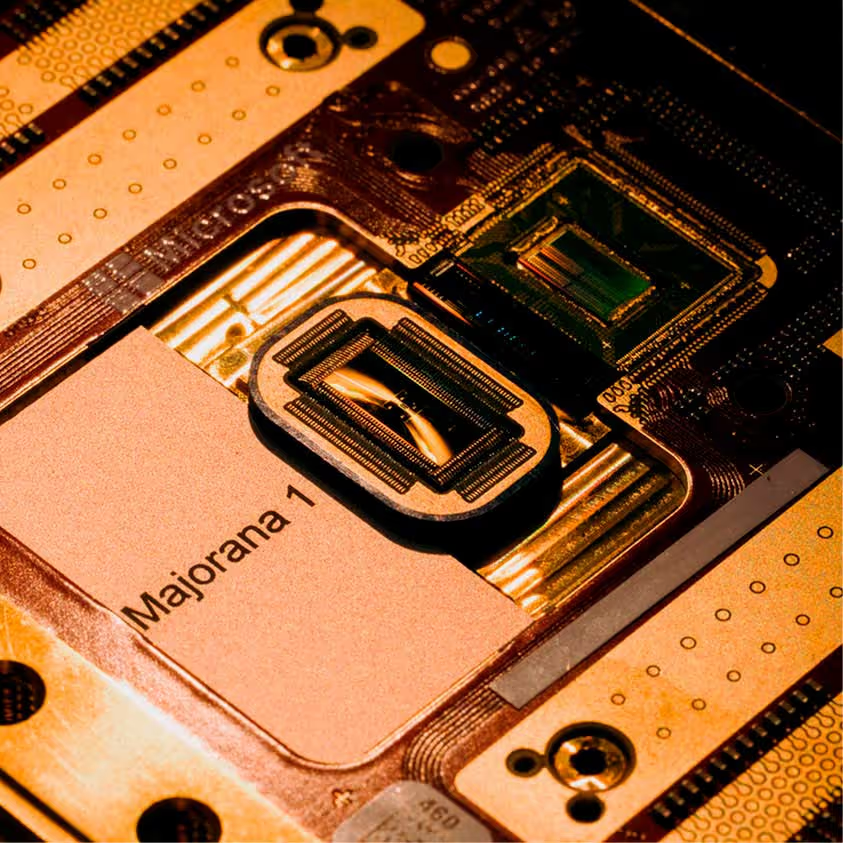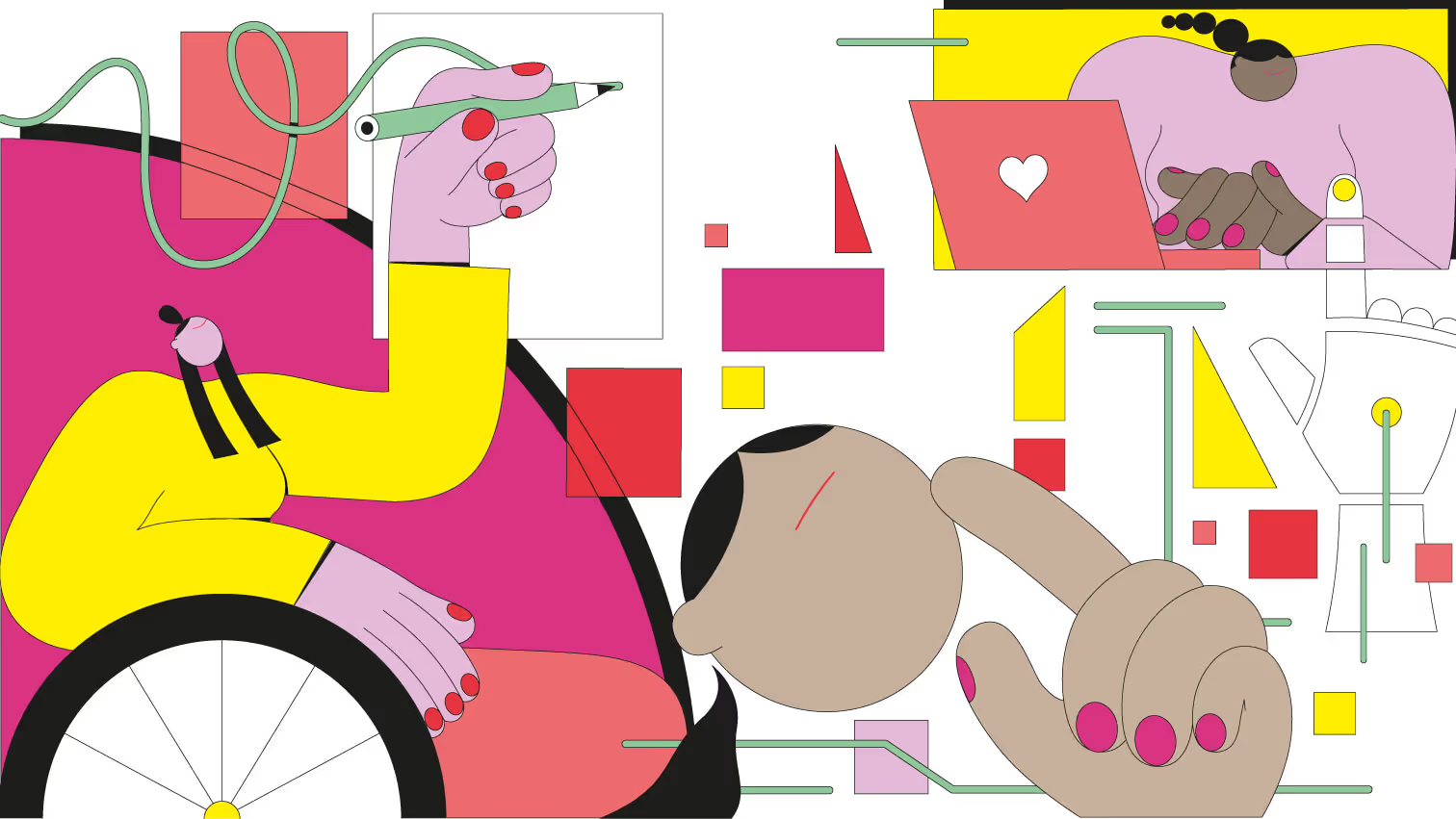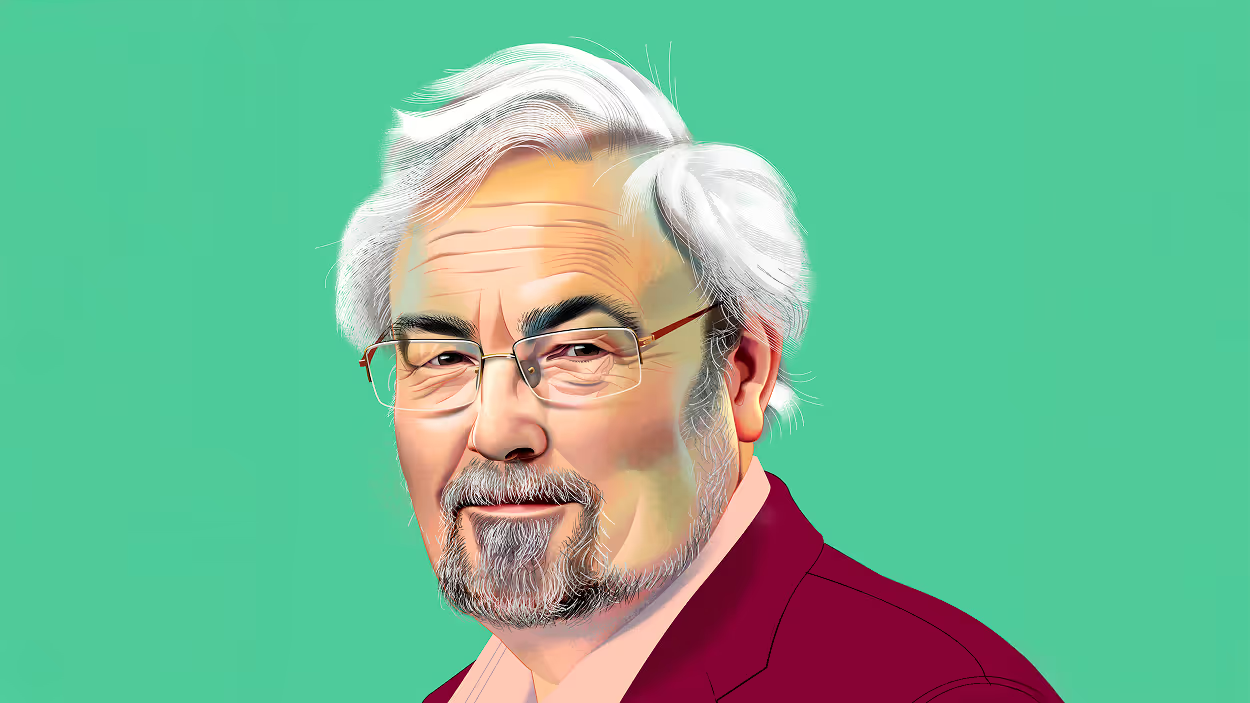Im Business-Spiel mischt die Kultur die Karten
Unternehmenskultur ist kein statisches Konzept: Werte, Regeln und Rituale müssen sich fortlaufend neu bewähren und vor allem in Zeiten des Wandels gezielt überprüft und weiterentwickelt werden. Eine starke Firmenkultur bildet das Fundament für Innovationen, Kooperation und Resilienz eines jeden erfolgreichen Unternehmens.
Ihre Kunden ändern sich, Ihre Produkte ändern sich, und die Technik, mit der Sie fertigen, entwickelt sich weiter. Aber wie sieht es mit Ihrer Unternehmenskultur aus? Wenn Ihr Unternehmen wie die meisten anderen aufgestellt ist, dann hat sich dessen Kultur vermutlich seit Jahren nicht geändert. „Unternehmenskultur verändert sich in der Regel nur allmählich, und nur auf einer Metaebene“, sagt Charlie Sull, Mitgründer von CultureX, einem Beratungsunternehmen, das eine der größten Studien zu dem Thema durchgeführt hat. Das leuchtet ein. Die menschliche Natur verändert sich in ihrem Kern schließlich auch nicht. Wenn sich aber alle Aspekte einer Firma wandeln, wie kann die Kultur dann stets dieselbe bleiben?
Eine demotivierend oder gar entfremdend empfundene Arbeitsumgebung sollte man umgestalten. In Teams mit einem ausgeprägten Gemeinschaftsgefühl und klarer Kommunikation bleiben Mitarbeiter länger und sie engagieren sich stärker. Eine Kultur, die Werte und Ziele glaubwürdig widerspiegelt und aktiv pflegt, kann Orientierung geben und sich als nachhaltiger Wettbewerbsvorteil erweisen. In vielerlei Hinsicht kann Kultur als Übereinkunft innerhalb einer Gruppe begriffen werden, als ein flexibles Gefüge, das sich fortwährend verändert. Zugleich lässt sich Kultur als Betriebssystem eines Unternehmens verstehen: Es definiert die grundlegenden Spielregeln, auf deren Basis Kooperation und Fortschritt möglich werden. Gemeinsame Überzeugungen und Verhaltensweisen, Rituale und Routinen sorgen dafür, dass Spitzenkräfte, Mitarbeiter und externe Partner zusammenfinden und kooperieren.
Das kulturelle Profil eines Unternehmens wirkt sich messbar auf seinen Geschäftserfolg aus. So können gelebte Werte am Arbeitsplatz die Arbeitsproduktivität um bis zu 24 % steigern, fanden Forscher der University of Oxford, des MIT und der Erasmus-Universität Rotterdam heraus. Firmen mit einem kreativen Kulturprofil melden mehr und bedeutendere Patente an, stellten Forscher der Universität Rom fest. Umgekehrt neigen Banken mit einer aggressiven, wettbewerbsorientierten Kultur zu riskanteren Kreditvergaben. Diese zogen höhere Ausfallraten und damit Verluste nach sich, wie eine Untersuchung der University of St. Andrews in Großbritannien zeigte.
So stark steigt die Produktivität zufriedener Mitarbeiter.
Das kulturelle Profil eines Unternehmens wirkt sich messbar auf seinen Geschäftserfolg aus. So können gelebte Werte am Arbeitsplatz die Arbeitsproduktivität um bis zu 24 % steigern, fanden Forscher der University of Oxford, des MIT und der Erasmus-Universität Rotterdam heraus. Firmen mit einem kreativen Kulturprofil melden mehr und bedeutendere Patente an, stellten Forscher der Universität Rom fest. Umgekehrt neigen Banken mit einer aggressiven, wettbewerbsorientierten Kultur zu riskanteren Kreditvergaben. Diese zogen höhere Ausfallraten und damit Verluste nach sich, wie eine Untersuchung der University of St. Andrews in Großbritannien zeigte.
Führungskräfte sollten ihre kulturellen Trümpfe gut kennen – und ihre Karten neu mischen, bevor Leistung und Gewinn in Mitleidenschaft gezogen werden. Eine Korn-Ferry-Umfrage unter 500 Topmanagern zeigt: Zwei Drittel beziffern den Beitrag ihrer Firmenkultur zum Marktwert ihres Unternehmens mit 30 % oder mehr, ein Drittel sogar mit mindestens 50 %.
Als Konzept fand Unternehmenskultur erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts Eingang ins Management. Wissenschaftler und Unternehmen versuchten damals, das Wechselspiel zwischen Werten und Leistung besser zu durchdringen. Zunächst muss die Führungsebene die Kultur eines Unternehmens richtig definieren. Sie meinen, das hätten Sie längst getan? Seien Sie sich nicht zu sicher. Studien zeigen kaum einen Zusammenhang, teils sogar eine negative Korrelation zwischen den Werten, die das Topmanagement für maßgeblich hält, und dem tatsächlichen Verhalten der Mitarbeiter im Unternehmen.
Die Kluft rührt daher, dass Führungskräfte das Wesen ihrer Unternehmenskultur häufig nicht richtig erfassen. Mats Alvesson, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Lund in Schweden, hat festgestellt, dass Manager oft eine unpassende artifizielle Unternehmenskultur entwickeln: Mitarbeiter tun in dieser Vorstellung einfach das, was die Führung verlangt. Der wahre Charakter der Firma wird außer Acht gelassen. Langfristig schadet ein solches Konzept der Gesundheit der Mitarbeiter und der Produktivität.
Selbst Unternehmen, die sich um eine ehrliche Selbstanalyse bemühen, scheitern oft: Viele verlassen sich noch immer auf die klassische Mitarbeiterbefragung – eine Methode, die 1932 entwickelt wurde und deren Aussagekraft in der heutigen dynamischen Arbeitswelt zunehmend an ihre Grenzen stößt. Nur wenige Unternehmen nutzen bereits moderne KI-Tools, um die vielschichtigen Facetten ihrer Unternehmenskultur präzise zu erfassen. Alvesson empfiehlt, gezielt spezifische Praktiken und die Reaktionen der Mitarbeiter zu untersuchen. Sein Rat: Zeichnen Sie ein Meeting auf und lassen Sie die Interaktionen von externen Spezialisten analysieren. So werden blinde Flecken sichtbar, die interne Befragungen oft übersehen.
Auch mit einfacheren Mitteln lässt sich die Unternehmenskultur analysieren. Cary Cooper, Professor für Organisationspsychologie und Gesundheit an der Manchester Business School, empfiehlt einen pragmatischen Ansatz: Bitten Sie Mitarbeiter, fünf Adjektive zu nennen, die ihr Unternehmen charakterisieren. Häufig zeigt sich dabei, dass deren Vorstellungen kaum mit dem Bild übereinstimmen, das das Topmanagement von der eigenen Unternehmenskultur hat. Mehr noch: Oft unterscheidet sich die Wahrnehmung selbst zwischen einzelnen Abteilungen und innerhalb von Teams sehr stark. „Sie werden feststellen, dass völlig unterschiedliche Vorstellungen existieren“, sagt Cooper. „Eine Gruppe hat ihre Sicht, der die Mehrheit innerhalb dieser Gruppe zustimmt, während eine andere Gruppe die Kultur ganz anders beschreibt.“
Letztendlich ist eine Diskussion immer noch der beste Weg, um die Kernelemente der Kultur zu klären: „Man sollte offene und sachliche Diskussionen anstreben und sein Handeln reflektieren. Fragen Sie sich selbst: Was meinen wir wirklich mit diesen Worten? Ist das tatsächlich das, was uns leitet?“, schlägt Alvesson vor, Co-Autor des Buches Changing Organizational Culture. Manchmal kann ein Blick in die Vergangenheit wichtige Anhaltspunkte dafür liefern, wie man vorankommt. Bill Carr, ehemaliger Amazon-Manager und Co-Autor von Working Backwards, empfiehlt, Führungskräfte danach zu befragen, welche Prinzipien sie befolgt und wie sie sich verhalten hätten, als sie das Unternehmen gründeten oder in es eintraten. Man brauche jemanden, der die Führungskräfte mit derartigen Fragen löchere, betont Carr.
Sometimes, looking to the past can offer important precedents and clues about how to go forward. For a deeper grounding, Bill Carr, a former long-time Amazon executive and co-author of Working Backwards: Insights, Stories, and Secrets from Inside Amazon, suggests interviewing executives about the principles they followed when they founded the company. “You need someone to go out and speak with the top leaders and role model leaders in the company and ask them a series of questions about what are the defining behaviors and principles that they observe? What has made this company great?” he says.
“Man sollte offene und sachliche Diskussionen anstreben und sein Handeln reflektieren. Fragen Sie sich selbst: Was meinen wir wirklich mit diesen Worten? Ist das tatsächlich das, was uns leitet?”
Andere Unternehmen wollen ihre Kultur mit einem umfassenderen Ansatz genauer unter die Lupe nehmen: Netflix ist bekannt für eine PowerPoint-Präsentation, die erstmals 2009 veröffentlicht wurde und auf 125 Folien zentrale Prinzipien und Werte darlegt.
Der Kulturleitfaden, zuletzt 2024 überarbeitet, spiegelt inzwischen jedoch nicht mehr nur die aktuellen Vorstellungen des Managements wider, sondern beinhaltet auch mehr als 1.500 Kommentare der über 13.000 Mitarbeiter zur Unternehmenskultur. Die Agenda basiert auf vier Prinzipien: Netflix versteht sich erstens als „professionelles Sportteam, nicht als Familie“. Zweitens stehen die Menschen über den Prozessen, Mitarbeiter genießen große Entscheidungsfreiheiten. Drittens verfolgt der Streamingdienst das Leitmotiv, „produktiv unbequem“ zu sein, eine Voraussetzung für Erfolg durch Wandel. Und viertens strebt Netflix danach, „großartig und immer besser zu werden“.
Software company HubSpot has another oft-quoted culture deck that states: “We obsess over our culture just like our product. Because culture is a product. We are building two products: One for our customers. One for our employees. Culture is the product we build for ourselves.”
Kultur führt ein Eigenleben: Sie entsteht und entwickelt sich, ganz gleich, ob sie bewusst gestaltet wird oder ob sie sich von innen heraus verändert. Damit stellt sich die Frage, ob und wie sie nach einer Bestandsaufnahme fortentwickelt werden sollte. „Eine Unternehmenskultur kann sich selbst in kurzer Zeit deutlich verbessern“, erläutert CultureX-Mitgründer Sull. Voraussetzung dafür sei indes, „dass die Spitze die Firmenkultur kennt, sie ernsthaft weiterentwickeln will und auch weiß, welche Schritte zu unternehmen sind“.
Oft überdauert eine Unternehmenskultur ihren ursprünglichen Zweck. Vielleicht wechseln Teams ständig und die Menschen, die heute für ein Unternehmen arbeiten, sind kurzfristige Vertragspartner. Vielleicht stehen die Geschäftsbestrebungen des Managements, ein kostengünstiger Dienstleister zu sein, inzwischen im Widerspruch zu einer Kultur, die einen persönlichen, hochwertigen Service verlangte. Oder vielleicht müssen sich die Führungskräfte auch daran gewöhnen, dass die Kunden bald nicht einmal mehr Menschen sind.
Roger Martin, emeritierter Professor für strategisches Management an der Rotman School of Business der University of Toronto, sagt, dass Führungskräfte mit Selbstreflexion beginnen sollten. Sie sollten herausfinden, wohin sie wollen. „Was ärgert Sie wirklich an Ihrem aktuellen Ergebnis im Vergleich zu den Ergebnissen, die Sie sich wünschen? Wo klafft die größte Lücke zwischen Ihren Erwartungen und dem, was tatsächlich geschieht?“, fragt Martin. „Wenn Sie die Lücke schließen wollen, müssen Sie eine ganze Reihe weiterer Entscheidungen treffen.“
Eine der effektivsten Methoden, eine Unternehmenskultur zu erneuern, ist Amazons Erfolgsstrategie, radikal vom Kunden aus zu denken. Das heißt, sich konsequent zu fragen, was das Unternehmen heute braucht, um Kunden zu begeistern und langfristig zu binden. Laut Carr war diese kompromisslose Kundenorientierung der Schlüssel zu Amazons Erfolg und prägte die Unternehmenskultur maßgeblich. So wuchs das Unternehmen von nur elf Mitarbeitern im Jahr 1995 auf über 1,5 Millionen Beschäftigte 2024.
Die eigene Firma zu verstehen und die passenden Unternehmensziele zu entwickeln, ist nur der erste Schritt für einen Kulturwandel. Danach folgt der schwierigere Teil: den Wandel vorantreiben. „Führungskräfte entwickeln Gewohnheiten. Zu erwarten, dass jemand diese plötzlich ohne drastische Intervention ändert, ist unrealistisch“, sagt Carr.
Cooper empfiehlt, sich auf ein konkretes Ziel zu konzentrieren und den Teams viel Spielraum auf dem Weg dorthin zu lassen.
Eine Möglichkeit ist die Auswahl eines geeigneten Indikators, mit dem man kulturellen Wandel messen kann, wie beispielsweise die Veröffentlichung von geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden als Maßstab für den Grad der Chancengleichheit in einem Unternehmen. „So findet Veränderung statt“, erklärt Cooper. Bei Amazon sorgen derartige Führungsprinzipien für Fokussierung. Carr sagt, sein ehemaliger Chef Jeff Bezos habe früh erkannt, „dass es nicht ausreicht, Prinzipien zu formulieren. Er wollte herausfinden: Wie schaffe ich skalierbare, wiederholbare Prozesse und Mechanismen, um die Prinzipien im Arbeitsalltag zu verankern?“
“FÜHrungskräfte entwickeln Gewohnheiten. Zu erwarten, dass jemand diese plötzlich ohne drastische Intervention ändert, ist unrealistisch.”
Eine gängigere Methode besteht darin, dass Topmanager gewünschtes Verhalten vorleben. Man sollte „die Veränderung sein, die man in der Welt sehen möchte“, sagt Martin und bezieht sich dabei auf Gandhi. Eines seiner Lieblingsbeispiele ist A. G. Lafley, der ehemalige CEO von Procter & Gamble. Lafley machte Filialbesuche und Kundengespräche zum festen Bestandteil jeder Auslandsreise. „Sagte Lafley zum Leiter von P & G Türkei: ‚Das müssen Sie so machen?‘ Nein, das sagte er nicht, sondern ging einfach mit gutem Beispiel voran“, erklärt Martin. So war er den Mitarbeitern ein Vorbild und machte ihnen zugleich den Stellenwert von Kunden klar.
Wichtig ist auch, dass alle Managementebenen mitziehen. Spencer Harrison, Professor für Organisationsverhalten an der INSEAD Business School, betont, dass mittlere Führungskräfte oft unterschätzt würden. „Wir geben Topmanagern zu viel Einfluss bei der Gestaltung der Kultur und lassen den Führungskräften auf unteren Ebenen kaum Spielraum“, sagt er. „Natürlich geben die Chefs die Richtung vor. Doch gerade die Führungskräfte im mittleren Management prägen die Kultur im direkten Arbeitsumfeld – und dort entscheidet sich, wie eine Unternehmenskultur gelebt wird.“
Die Kultur eines Unternehmens lässt sich ohne klare Botschaft kaum neu gestalten, sagt Zach Mercurio, Forscher am Center for Meaning and Purpose der Colorado State University und Autor von The Power of Mattering. Seiner Ansicht nach hat die Sprache, wie sie in der Managementausbildung vermittelt wird, den Aufbau starker Firmenkulturen eher behindert als gefördert. Wenn etwa der Umgang mit Menschen als „Soft Skill“ kategorisiert wird, entstehe schnell der Eindruck, diese Fähigkeit sei weniger wichtig. Mercurio kritisiert, dass sich menschliche Kommunikation immer häufiger auf kurze Impulse wie Textnachrichten oder Emojis beschränkt. So nehmen wir uns immer weniger Zeit für echten Austausch. „Wir skalieren Prozesse der Produktentwicklung, wir skalieren das Management von Lieferketten – aber menschliche Fähigkeiten skalieren wir nicht so gut“, stellt Mercurio fest.
Gute Kommunikationsfähigkeiten bleiben entscheidend. Für Mercurio fängt eine erfolgreiche Unternehmenskultur mit einem respektvollen Verhalten an: „Es wird schnell schwierig, wenn ständig von Zusammenhalt, Sinnhaftigkeit des Unternehmens oder der Wertschätzung der Mitarbeiter gesprochen wird. Erlebe ich im Alltag jedoch immer wieder das Gegenteil, führt das eher zu Frustration und letztlich zu mehr Unzufriedenheit und einer höheren Fluktuation im Unternehmen.“
Bei global agierenden Konzernen muss die Unternehmensspitze besonders viel Aufwand betreiben, um alle Beteiligten über Landesgrenzen und kulturelle Gepflogenheiten hinweg zusammenzubringen. „Der chinesische Manager lernt, einen Kollegen niemals offen oder vor anderen zu kritisieren, während der niederländische Manager lernt, immer ehrlich zu sein und seine Botschaft direkt zu übermitteln. Amerikaner werden darauf trainiert, negative Nachrichten in positive zu verpacken, während Franzosen lernen, leidenschaftlich zu kritisieren und Lob sparsam zu dosieren“, schreibt Erin Meyer in ihrem viel beachteten Buch Die Culture Map.
Um den zahlreichen Missverständnissen frühzeitig zu begegnen, die kulturelle Unterschiede mit sich bringen, hat die Professorin von der INSEAD die sogenannte „Culture Map“ entwickelt: Diese beschreibt ein Rahmenwerk, das nationale Kulturen entlang verschiedener Achsen unterscheidet – etwa zwischen solchen, in denen Kommunikation explizit und direkt erfolgt, und solchen, in denen eher indirekt kommuniziert wird. Wenn man diese unsichtbaren Barrieren sichtbar macht, kann das einen positiven Beitrag zur Firmenkultur leisten.
Wenn Führungskräfte ihre Mitarbeiter dazu inspirieren, ihre Arbeit im Kontext eines übergeordneten Ziels zu betrachten, kann das ebenfalls die Firmenkultur stärken. Eine Werbekampagne des indischen Unternehmens Tata Steel aus dem Jahr 1989 rückte den humanitären Beitrag des Konzerns in den Mittelpunkt. Mit dem Slogan „Wir produzieren auch Stahl“ lenkte die Kampagne den Blick weg vom Produkt hin zur nationalen Entwicklung Indiens.
Eine oft erzählte Anekdote handelt von John F. Kennedy, der einen Hausmeister im Raumfahrtzentrum Cape Canaveral fragt, was er dort tue. „Ich helfe dabei, einen Mann auf den Mond zu bringen“, antwortet er. Die kleine Geschichte ist charmant, geht aber tiefer: Sie offenbart, dass die langfristige Perspektive des Hausmeisters weit über den eigenen Tellerrand hinausging.
Dieses Denken hatte die Raumfahrtbehörde gezielt unter den rund 400.000 Menschen verankert, die in den 1960er-Jahren am Apollo-Programm mitarbeiteten. „Bei der NASA gab es damals sogenannte ‚Leitern zum Mond‘, die in den Einrichtungen auf Tafeln geschrieben standen“, erklärt Mercurio. „Ganz unten stand das, woran das Team in dem jeweiligen Monat arbeitete. Eine Stufe darüber: ein greifbares Ziel, für das diese Arbeit notwendig war. So ging es weiter bis ganz nach oben, wo schließlich zu lesen war, wie das alles dazu beitrug, bis Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen.“
Für Mercurio dient der Ansatz der NASA als Vorbild: „Man sagt den Leuten nicht nur, dass sie sich mit dem großen Ziel identifizieren sollen. Man zeigt ihnen auf anschauliche Weise, dass ihre Arbeit einen messbaren Beitrag leistet.“ Organisationen können Geschichten nutzen, die ihre Kultur stärken. Erzählungen helfen Menschen, sich in Gruppen zu verorten und Ziele zu definieren, erklärt Angus Fletcher, Professor an der Ohio State University. Marc Benioff, Gründer und CEO der Tech-Firma Salesforce, nutzt für seine Erzählung den hawaiianischen Begriff für Familie: Ohana. Das Unternehmen hat laut seiner Erzählung die Idee verinnerlicht, „dass Familien miteinander verbunden und ihre Mitglieder füreinander verantwortlich sind“. Diese Definition der Kultur wird prominent in Unternehmensmaterialien und bei der Personalsuche eingesetzt.
But the coming decade may prove challenging for corporate storytellers – indeed, for anyone trying to shape culture – as AI becomes increasingly integrated into the workforce. Despite its advances, AI still suffers from a structural inability to create stories that aren’t just rehashes of older stories, Fletcher argues, calling it “a glitch” that will limit its creative value. Other scholars have pointed out that AI can’t empathize the way people can, an ability that constitutes a key part of innovation.
If the bots can’t tell a good story and they can’t feel, how will they fit into the culture? Better than you might think. For one thing, human beings tend to play nicely with them. Hardwired for empathy, we tend to share, even with virtual creatures.
“MAN ERZÄHLT LEUTEN NICHT NUR, DASS SIE EINEM GRÖSSEREN ZWECK DIENEN. MAN ZEIGT IHNEN, DASS IHRE ARBEIT EINE WIRKUNG HAT.”
Doch das kommende Jahrzehnt könnte sich für Storyteller in Unternehmen als herausfordernd erweisen. Gleiches gilt für alle, die Kultur prägen wollen, weil KI zunehmend Eingang in die Arbeitswelt findet. Trotz aller Fortschritte kann Künstliche Intelligenz bislang keine Geschichten erschaffen, die nicht einfach neue Aufgüsse älterer Erzählungen sind. Für Fletcher ist das ein Fehler im System, der den kreativen Nutzen von KI begrenzen wird. Andere Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass KI nicht zu Empathie fähig ist – eine Fähigkeit, die einen wesentlichen Teil von Innovationen ausmacht.
Wenn Maschinen jedoch keine Geschichten erzählen und nichts empfinden, wie sollen sie dann Teil einer Unternehmenskultur werden? Eines immerhin steht fest: Menschen kommen erstaunlich gut mit den neuen KI-Agenten aus. Weil wir auf Empathie gepolt sind, teilen wir unsere Gedanken mit anderen, sogar mit virtuellen Wesen.
Auch als Teamkollegen erweisen sich KI-Systeme inzwischen als überraschend leistungsfähig. Eine aktuelle Studie der Harvard Business School untersuchte den Einsatz von KI bei 776 erfahrenen Vertriebs- und F&E-Fachkräften von Procter & Gamble während eines eintägigen Seminars. Dabei wurde die Kreativität von vier Gruppen miteinander verglichen: Personen, die allein arbeiteten, Teams ohne KI, Teams mit einem generativen KI-System (GenAI) als Mitglied sowie Einzelpersonen, die mit Unterstützung eines GenAI-Systems arbeiteten. Am besten schnitten die Teams mit einem GenAI- Kollegen ab, und fast alle herausragenden Lösungen entstanden in Gruppen mit einem GenAI-Mitglied.
Ethan Mollick von der Wharton School der University of Pennsylvania, der das Zusammenarbeiten mit KI erforscht, sieht in den Ergebnissen einen klaren Hinweis: Unternehmen sollten ihre Teamstrukturen, Trainingsformate und die Grenzen zwischen Fachbereichen überdenken. Mit anderen Worten: Sie sollten sich erneut daranmachen, ihre Kultur zu definieren. Wenn respektvolle und transparente Zusammenarbeit, ob im rein menschlichen Team oder gemeinsam mit GenAI-Kollegen, entscheidend dafür ist, müssen die Kulturkarten neu gemischt werden, um nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Immer einen Schritt voraus!
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und lassen Sie sich von Think:Act auf den neuesten Stand bringen – mit dem, was heute wichtig ist, und mit Orientierung für das, was als Nächstes kommt.