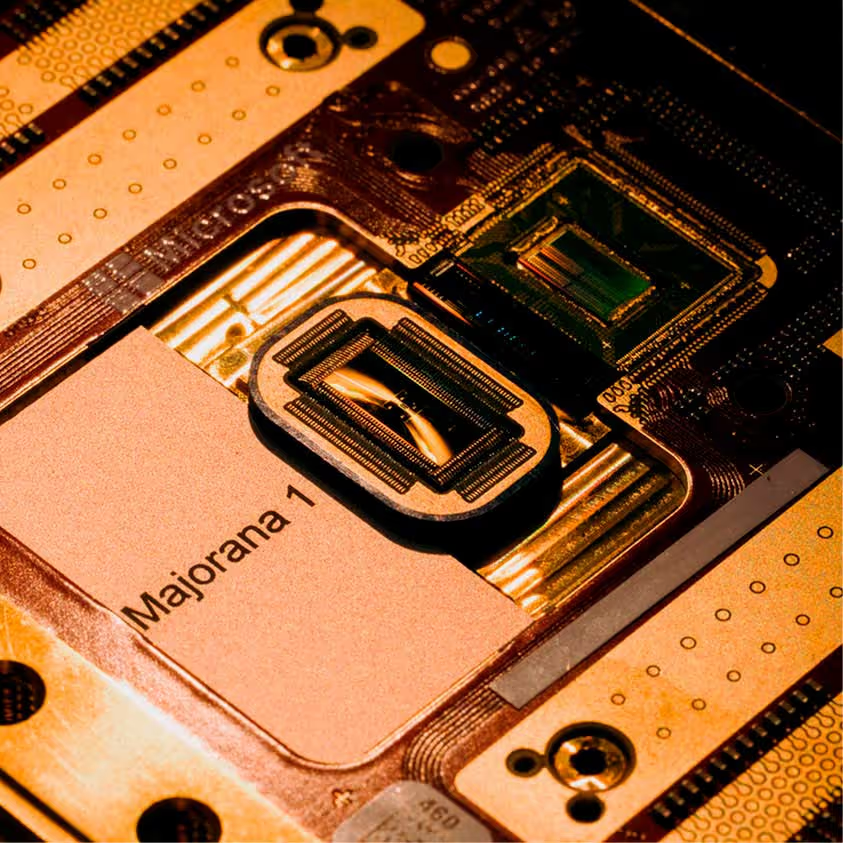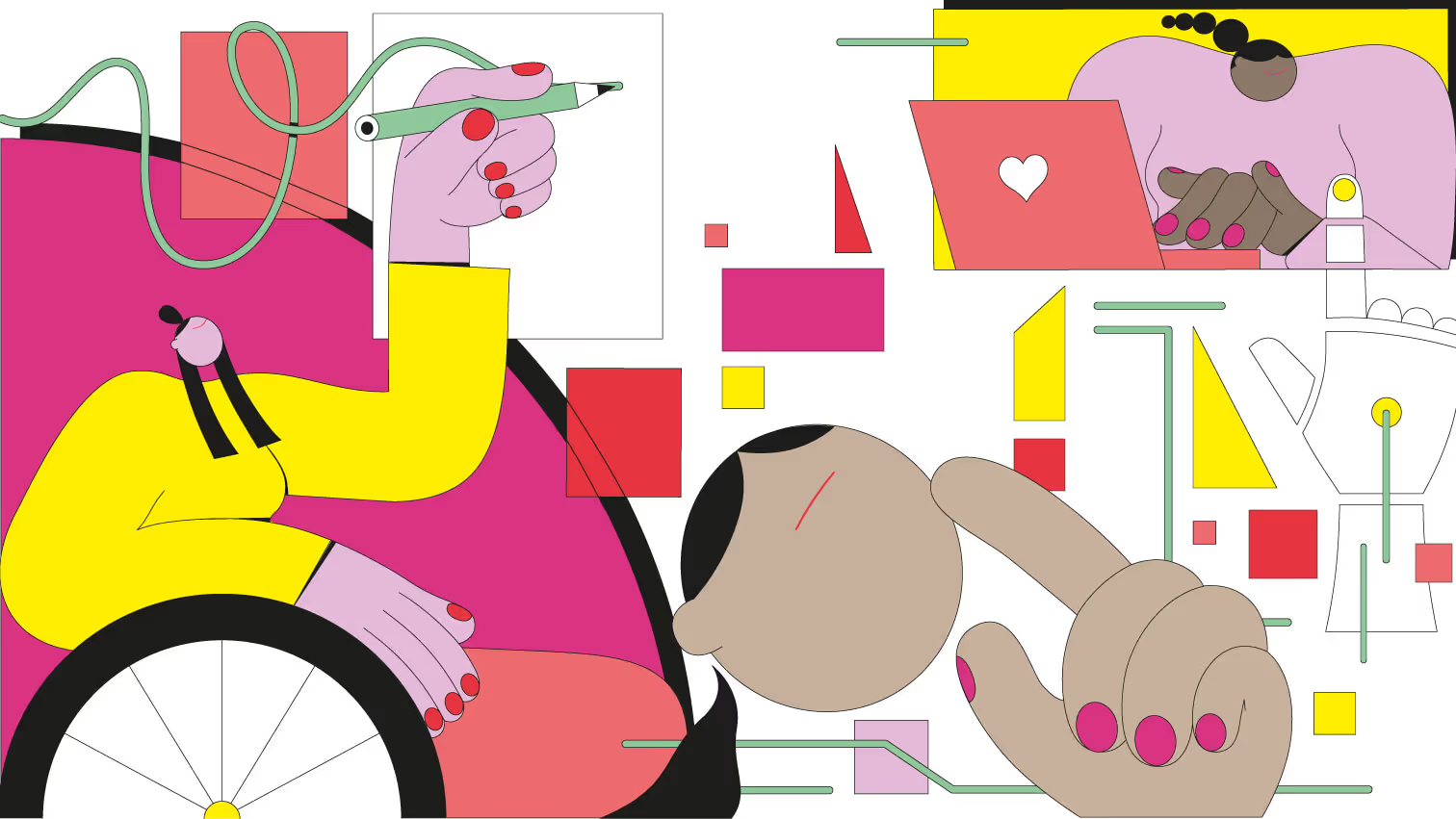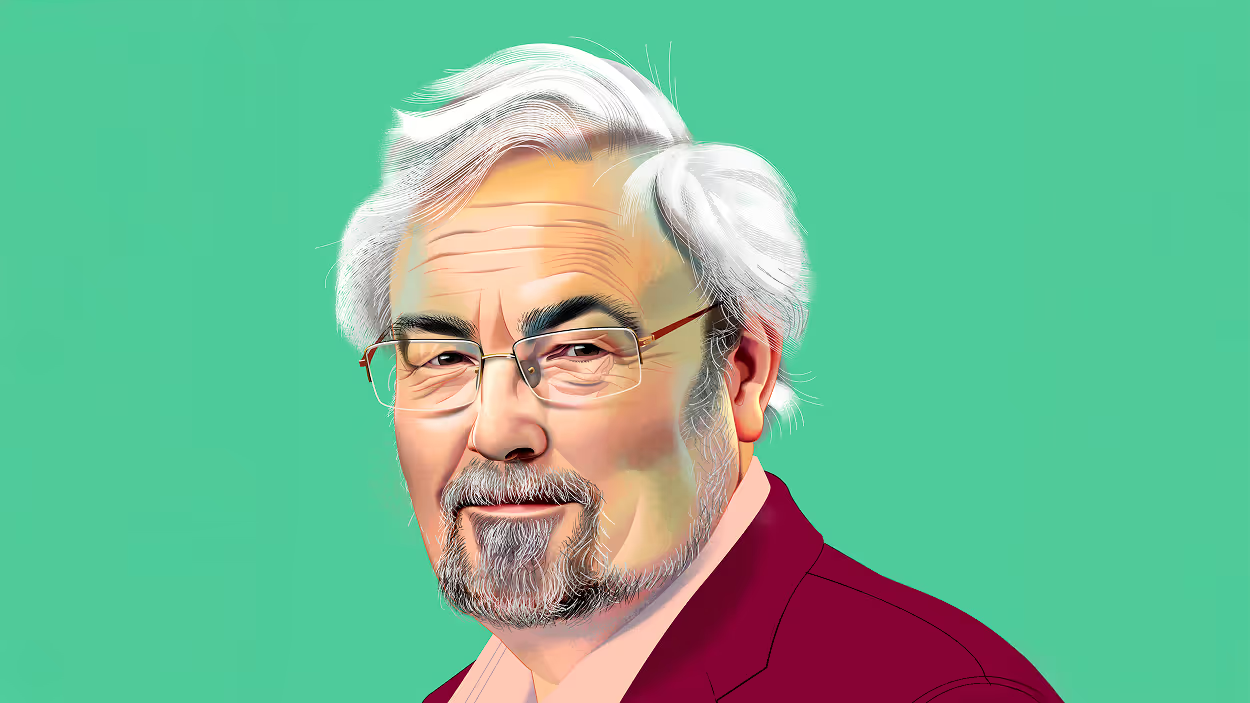Der Bauplan für Erfolg in der Führungsebene
Shellye Archambeau wusste schon mit 16 Jahren, dass sie CEO werden will. Als erste schwarze Frau, die IBM im Ausland vertrat, und als Saniererin einer Tech-Firma im Silicon Valley ist sie überzeugt: Es lohnt sich, ehrgeizig zu sein, früh einen klaren Lebensweg einzuschlagen und Diversitätsziele zu verfolgen.
Wenn Wünsche in Erfüllung gehen, verläuft das selten so, wie man es sich vorgestellt hat. Das merkte auch die IBM-Führungskraft Shellye Archambeau, als sie kurz nach dem Platzen der Dotcom-Blase den Anruf bekam, CEO eines Tech-Unternehmens im Silicon Valley zu werden. Schnell zeigte sich: Die vielen Erfahrungen mit Widerständen seit ihrem Besuch einer „all-white school“ hatten sie genau darauf vorbereitet. „Es waren die frühen 2000er, und das Valley vibrierte vor Kreativität. Ich nahm an, dass es dort auch ein vielfältiges Umfeld geben würde. Tatsächlich aber gab es kaum Frauen oder Minderheiten in Führungsrollen. Ich dachte nur: Also gut, wieder einmal durchkämpfen.“ Was für sie den Unterschied machte, sagt Archambeau im Gespräch mit Think:Act, war vor allem eines: den eigenen Weg früh planen, regelmäßig hinterfragen und den Kurs rechtzeitig anpassen.

Sie vergleichen das Leben und das Erreichen von Zielen mit dem Job eines Piloten: Man hebt ab mit einem klaren Ziel und einem Flugplan. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um diese Ziele und den Weg dorthin zu definieren?
Es ist nie zu früh, um zu planen. Und auch nie zu spät. Wer keine Ziele hat, keine klare Vorstellung davon, wohin die Reise gehen soll, kann seine täglichen Entscheidungen kaum sinnvoll ausrichten. Ein Ziel vor Augen zu haben, hilft dabei, die eigene Energie zu bündeln. So steigen die Chancen, es tatsächlich zu erreichen.
Nur wenige Jugendliche haben schon in der Schulzeit ein klares Karriereziel, und kaum einer verspürt den Wunsch, einmal CEO zu werden. Was hat Sie dazu gebracht, so früh so hoch hinauszuwollen?
Mir wurde schon früh klar, dass ich nicht die besten Chancen hatte, meine Träume zu verwirklichen. Also habe ich angefangen, sehr gezielt darüber nachzudenken, wie ich es trotzdem schaffen kann. Eine Berufsberaterin fragte mich, ob ich studieren wolle und was ich danach vorhabe. Ich wusste es nicht. Ich wollte einfach nur genug Geld verdienen. Sie fragte: „Was machst du denn gern?“ Ich sagte: „Ich liebe meine AGs.“ Ich war überall dabei und habe oft die Leitung übernommen. Daraufhin sagte sie, das sei wie im Geschäftsleben. Man bringe Menschen zusammen und setze Dinge um. Als ich mit 16 herausfand, dass die Menschen, die Unternehmen führen, CEOs heißen, habe ich meinen Eltern gesagt: Ich will auch CEO werden.
Sie wollten nicht nur beruflich erfolgreich sein, sondern auch eine Familie gründen. Geht beim Planen nicht auch etwas verloren, zum Beispiel die Freiheit, Interessen einfach auszuprobieren?
Als ich für mich festgelegt habe, was ich vom Leben will, war das Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre. Und wenn ich mich damals umsah, waren CEOs in der Regel Männer mit Ehepartnerinnen, die zu Hause blieben. Mir wurde klar, dass ich jemanden finden musste, der bereit wäre, meine Karriere zu unterstützen. Ich habe einen Mann gefunden, den ich über alles liebe. Und er war bereit, mich und unsere Familie zu unterstützen.
Unabhängig davon, für welche Branche man sich entscheidet, geben Sie einen sehr klaren Rat: „Egal, was du im Leben machen willst, der beste erste Job ist ein Vertriebsjob.“ Warum?
Bis heute nutze ich die Fähigkeiten, die ich im Vertrieb gelernt habe. Ein Vertriebsjob bedeutet vor allem: Lösungen finden. Man lernt, einen Raum zu lesen und zu verstehen, wo die Entscheidungsmacht tatsächlich liegt. Und man begreift, dass ein „Nein“ selten ein endgültiges Nein ist. Es bedeutet meistens: Etwas passt nicht – der Preis, der Zeitpunkt, die Zuständigkeit. Durch solche Absagen bekommt man die Chance herauszufinden, woran es liegt und wie man es ändern kann. Man lernt außerdem, wie man Teams aufbaut.
Gleich nach Ihrem Bachelorabschluss an der Wharton School sind Sie bei IBM eingestiegen. Ist ein Großkonzern heute noch immer der beste Ort, um sich auf eine Führungsrolle vorzubereiten – und vielleicht sogar ein teures MBA-Programm zu umgehen, so wie Sie es getan haben?
Das kommt darauf an, welche Art von Führungspersönlichkeit man werden möchte. Wer Unternehmen in größerem Maßstab führen will, findet in großen Konzernen hervorragende Möglichkeiten, um zu lernen, wie man Menschen führt und sie in ihrer Weiterentwicklung unterstützt. Ich habe die eine Hälfte meiner Karriere in Großunternehmen verbracht und die andere Hälfte in Start-ups. Diese Kombination halte ich für ausgesprochen wertvoll. Geht es auch andersherum? Ja. Aber es ist deutlich schwieriger, von der Erfahrung, ein eigenes Unternehmen aufgebaut zu haben, in die Führung eines großen internationalen Konzerns zu wechseln.
Während Ihrer 15 Jahre bei IBM wurden Sie schließlich als erste schwarze Frau des Unternehmens ins Ausland entsandt. Was war Ihre wichtigste Erfahrung – insbesondere während Ihrer Zeit in Japan?
Ich hatte mir in den USA viele Fähigkeiten angeeignet, die mir als Angehörige einer Minderheit abverlangt wurden. Genau diese haben mir später geholfen, als ich ins Ausland ging. Als schwarze Frau in der Techbranche weiß ich: Wenn ich eine neue Position übernehme, schauen die Leute erst einmal sehr genau hin. Sie fragen sich: Verdient sie diese Aufgabe wirklich? Kann sie das? Ich werde infrage gestellt. Also habe ich gelernt, mit genau solchen Situationen umzugehen. Und wenn man in einem anderen Land lebt, fühlt es sich ganz ähnlich an. Wer bist du? Warum glaubst du, dass du hierher gehörst? Wenn man solche Erfahrungen vorher nicht gemacht hat, kann es ein Schock sein. Denn das, was man erreicht hat, bringt einem nicht automatisch Ansehen. Man muss sich neu beweisen.

“Frauen werden dazu erzogen, sich ständig zu entschuldigen, um es anderen leichter zu machen. Wir müssen damit aufhören.”
Ihr ursprüngliches Ziel war es, CEO von IBM zu werden. Warum haben Sie sich schließlich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, in dem schon Ihr Vater gearbeitet hatte?
Das war die schwierigste Entscheidung meiner gesamten Laufbahn. Ich habe immer wieder Signale bekommen, dass ich wohl kaum eine echte Chance hätte, mich für den CEO-Posten zu qualifizieren. IBM war für mich wie ein Zuhause. Ich bin dort beruflich groß geworden, meine Freunde waren IBM-Kollegen, und ich war mit einem ehemaligen IBM-Mitarbeiter verheiratet. Das Unternehmen zu wechseln fühlte sich an, als würde ich meine Familie verlassen. Aber mein Wunsch, CEO zu werden, war stärker. Mir war klar: Wenn ich das erreichen will, muss ich woanders hingehen. Ich hatte bereits große Unternehmen geführt, mit Zehntausenden Mitarbeitenden und Milliardenbudgets. Ich wusste, wie das funktioniert. Warum also in einen anderen Großkonzern wechseln, wenn ich meine Erfahrung genauso gut auch dafür nutzen kann, etwas Neues aufzubauen?
Kurz nach dem Platzen der Dotcom-Blase fingen Sie im Silicon Valley an. Sie wurden CEO eines kleinen Unternehmens in Schieflage und haben in den nächsten 14 Jahren an der Sanierung gearbeitet. MetricStream gibt es bis heute. Was hat Ihnen das Vertrauen gegeben, dass Sie das schaffen können?
Ich bin ein sehr entschlossener und wettbewerbsorientierter Mensch. Ich war überzeugt, dass wir es schaffen werden, wenn wir ein starkes Team zusammenbringen und uns auf die entscheidenden Probleme konzentrieren. Was ich an Führungsaufgaben am meisten liebe, ist, anderen zu zeigen, dass sie mehr können, als sie selbst glauben.
Der Titel Ihres Buches bringt Ihre Haltung auf den Punkt: Unapologetically Ambitious. Meinen Sie damit, dass Frauen und Minderheiten oft das Gefühl vermittelt wird, sich für ihren Ehrgeiz entschuldigen zu müssen?
Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich – und andere – schon gehört haben: „Oh, du bist aber ehrgeizig!“ Und das war ganz sicher nicht als Kompliment gemeint. Man muss sich das mal vor Augen führen: Niemand würde seine Kinder so erziehen, dass sie sich anstrengen, gute Noten schreiben, Verantwortung übernehmen, sich engagieren, aber bloß nicht ehrgeizig sein sollen! Frauen werden dazu erzogen, sich ständig zu entschuldigen, um es anderen leichter zu machen. Wir entschuldigen uns, um Spannungen zu glätten und Empathie zu zeigen. Und ja, manchmal hilft das, damit die Dinge besser funktionieren. Aber wir müssen damit aufhören. Denn wenn wir uns ständig entschuldigen, glauben die Leute irgendwann, dass wir tatsächlich schuld sind. Es ist vollkommen in Ordnung, ehrgeizig zu sein.
Erfolg hängt oft stark von guten Mentoren ab. Wie findet man sie?
Mentoren sind für die Berufslaufbahn sehr wichtig. Studien zeigen, dass Menschen mit Mentoren in ihrer Karriere schneller vorankommen. Aber solche Menschen zu finden, ist nicht ganz einfach. Ich habe früh zwei Dinge gelernt: Mentoring muss nicht formell sein, und man kann auch mehrere Mentoren haben. Deshalb habe ich über meine gesamte Laufbahn hinweg immer wieder Menschen in diese Rolle geholt.
Then how do you sway them?
Well, I just started treating people like mentors, asking them for a little advice that only takes a minute. Hey, I’ve seen you present, and you do a really good job. I have a presentation coming up, can you give me just two quick pieces of advice? They wouldn’t even have to think about it. I’d take the advice and then come back a few weeks later. Thank you so much, it helped me give the best presentation so far. You probably don’t remember even giving me the advice, because it was no investment on your part. And now you get this “thank you note” and your heart feels warm. The next time I reach out, we start building a relationship. Before you know it, you’re mentoring me – and you never even signed up for it.
Führungskräfte sollten wissen, worin sie gut sind. Und laut gängiger Managementlogik auch an ihren Schwächen arbeiten. Sie vertreten eine andere Sicht und setzen bewusst auf die Stärken. Warum?
Man wird für seine Stärken wahrgenommen. Es sind genau diese Stärken, derentwegen man ins Team geholt oder für eine neue Position empfohlen wird. An den eigenen Schwächen zu arbeiten, bringt oft nur geringe Fortschritte, kostet aber unverhältnismäßig viel Zeit und Energie. Wenn ich eine echte Stärke habe, investiere ich lieber zwei Stunden zusätzlich, um sie weiter auszubauen. Schwächen sollte man im Blick behalten, damit sie nicht hinderlich werden. Aber man sollte keine Zeit damit vergeuden, sie in Stärken zu verwandeln.
“Diversität beginnt an der Spitze. Es geht um Führung, die konsequente Umsetzung und die Fokussierung auf das Ziel. Worte allein reichen nicht.”

Mit Ehrgeiz kommt auch die Gefahr, in Rollen gedrängt zu werden, in denen man sich noch nicht sicher fühlt. In solchen Situationen kennen viele das sogenannte Impostor-Syndrom, also das Gefühl, den eigenen Erfolg nicht wirklich verdient zu haben. Was ist aus Ihrer Sicht der beste Umgang damit?
Das Impostor-Syndrom ist in erster Linie eine Frage der inneren Haltung. Man hat das Gefühl, etwas nicht verdient zu haben, und fürchtet, als Hochstapler entlarvt zu werden. Besonders häufig betrifft das sehr kompetente und talentierte Menschen, vor allem Frauen. Ich weiß nicht, ob man das Gefühl je ganz loswird. Aber ich glaube, man kann lernen, damit umzugehen. Ein erster Schritt ist die Erkenntnis, dass es vielen so geht. Es liegt nicht an einem selbst. Es ist ein weitverbreitetes Phänomen. Und man sollte sich immer wieder klarmachen: Wenn andere einem etwas zutrauen, darf man dieses Vertrauen auch annehmen – selbst dann, wenn man es im ersten Moment nicht selbst verspürt.
Frauen stehen viel häufiger als Männer vor dem Dilemma, sich zwischen Karriere und Privatleben entscheiden zu müssen. Die Standardantwort darauf lautet: Work-Life-Balance. Wie sehen Sie das nach einem ganzen Berufsleben in Führungspositionen?
Ich mag den Begriff „Work-Life-Balance“ überhaupt nicht. Eine Balance ist etwas Statisches: zwei Gewichte auf einer Wippe, die sich nicht bewegen dürfen. Aber das Leben ist nicht statisch. Ich finde, wir sollten eher von „Work-Life-Integration“ sprechen. Was sind meine persönlichen und beruflichen Prioritäten? Man bringt beides zusammen und sortiert dann rigoros um. So stellt man sicher, dass das, was einem im Leben wichtig ist, auch tatsächlich erledigt wird. Dieser Ansatz erlaubt es, mit dem Leben mitzugehen. Es gibt Phasen, in denen der Beruf alles verlangt. Und es gibt Zeiten, in denen andere Dinge viel wichtiger sind.
Das Wall Street Journal hat Zahlen zu S&P-500-Unternehmen ausgewertet, die seit 2020 ihre Führung diverser aufstellen wollten. Das Fazit lautete: „Vielfaltsversprechen und DEI-Programme haben kaum zu mehr Diversität geführt.“ Im Jahr 2023 war nur jede 20. Führungskraft in den USA schwarz, also deutlich unter ihrem Anteil an der US-Arbeitsbevölkerung. Haben all diese Programme überhaupt etwas bewirkt?
Es ist schwierig, über den Durchschnitt zu sprechen, weil Unternehmen ganz unterschiedlich damit umgehen. Einige haben ihre Diversität tatsächlich deutlich verbessert. Andere wiederum haben Programme eingeführt, die wenig Wirkung gezeigt haben. Was ich mit Sicherheit sagen kann: In den Führungsgremien hat sich sehr viel getan. Sie sind heute deutlich vielfältiger als noch vor zehn Jahren, sowohl was das Geschlecht betrifft als auch die ethnische Herkunft. Meine Meinung ist: Diversität beginnt an der Spitze. Es geht um Führung, die konsequente Umsetzung und die Fokussierung auf das Ziel. Worte allein reichen nicht.
Derzeit scheint das Pendel in die Gegenrichtung auszuschlagen. Viele Firmen haben Begriffe rund um DEI aus ihren Leitbildern und der Unternehmenskultur gestrichen. Macht Ihnen das Sorgen?
Ich bin sehr enttäuscht, dass DEI inzwischen zu einem politischen Reizthema geworden ist und viele Unternehmen deshalb keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Es scheint, als würden manche denken: Wenn diese Begriffe zum Problem werden, dann ändern wir lieber die Sprache, um keinen Ärger zu bekommen. Ja, einige Unternehmen ziehen sich zurück. Aber bei Weitem nicht alle. Manche ändern die Begriffe, doch ihre Arbeitsweise bleibt die gleiche. Immer wieder haben Studien gezeigt: Je vielfältiger ein Team oder eine Organisation ist, desto besser ist am Ende die Leistung. Unterschiedliche Menschen bringen verschiedene Perspektiven ein. Das werden Firmen nicht einfach über Bord werfen. Aber sie sind gezwungen, Wege zu finden, wie sie unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen weiterarbeiten können.
Sie hatten für die zweite Phase Ihres Lebensplans Reisen und mehr Zeit mit ihrer Familie vorgesehen. Doch dann verloren Sie Ihren Mann. Würden Sie sich rückblickend wünschen, sich früher mehr um ihre Familie gekümmert zu haben?
Nein, ich würde nichts anders machen. Ich wurde mit 40 Jahren CEO eines Unternehmens und kam mit 50 in ein Board eines Fortune-500-Konzerns. Jede Änderung hätte mein Leben völlig anders verlaufen lassen. Trotz Härten und Tragödien bin ich insgesamt sehr glücklich mit meinem Leben. Als mein Mann zehn Jahre lang gegen seinen Krebs gekämpft hatte und ich erwog, beruflich kürzerzutreten, sagte er mir vom Krankenbett aus: „Wir haben uns entschieden so zu leben. Wenn du aufhörst, wofür kämpfe ich dann noch?“
Immer einen Schritt voraus!
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und lassen Sie sich von Think:Act auf den neuesten Stand bringen – mit dem, was heute wichtig ist, und mit Orientierung für das, was als Nächstes kommt.